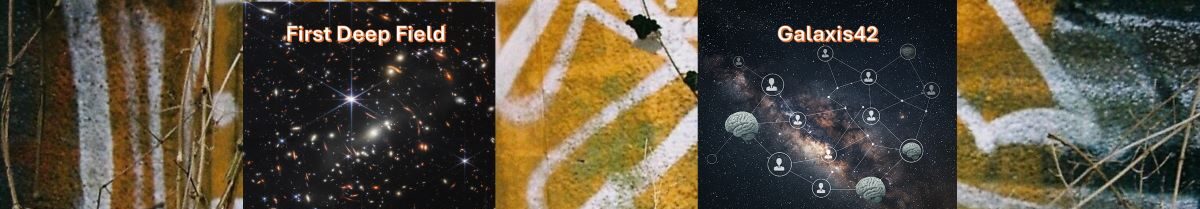Im Altertum ist der Mensch, aber nicht die Welt vergänglich, während im Christentum die Welt vergänglich ist, aber nicht der Mensch. Diese Umkehrung des Glaubens impliziert mannigfaltige Konsequenzen und erklärt letztlich den Umgang des Menschen mit sich selbst, seiner Umgebung und der Welt, in der er lebt. Denn wer nicht stirbt, darf sich Risiken aussetzen. Einer, der ewig lebt, kann zwar Ansehen, Vermögen und Ämter verlieren, aber nicht sein Leben oder das seiner Familie. Für ihn ist es nicht lebensbedrohlich, Kriege zu führen und die Welt zugrunde zu richten, die sowieso vergänglich ist. Natürlich bleibt die Unsicherheit, ob der Glaube wirklich trägt.
Die christlichen Werte prägen bis heute tief die europäische Kultur und mit ihr das Denken der gesamten westlichen Welt. Daher ist es wenig verwunderlich, dass zum Beispiel effektive Maßnahmen gegen den Klimawandel von vielen Verantwortlichen abgelehnt oder zumindest nicht vorangetrieben werden. Warum in eine Welt investieren, die sowieso untergeht? Selbst moderne Kriege verlieren ihren Schrecken, wenn durch sie das Leben nicht wirklich endet. Auch Menschen, die nicht aktiv glauben oder die christlichen Kirchen inzwischen sogar ablehnen, sind gesellschaftlich durch das Christentum geprägt.
Deren Logik gebietet, eher Ansehen und Vermögen zu mehren und zu schützen, weshalb Investitionen in Rüstung sinnvoller erscheinen als in Menschen oder die Natur, denen sowieso nicht zu helfen ist. Darüber hinaus erscheint es logisch, diese untergehende Welt möglichst schnell zu verlassen, um eine neue Heimat zu finden.