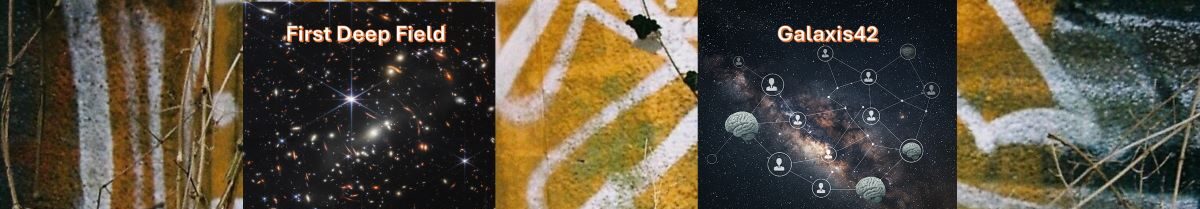Eine Journalistin aus München beginnt ihren Artikel zum Thema deutsche Kultur und Sprache mit der Überschrift: „The Famous German Easyness“. Dann schreibt sie: „Die Frage, wie wir Deutschen mit unserer eigenen Sprache und damit auch mit unserer Kultur umgehen, ob wir uns zum Beispiel deutschen Popsongs verwehren, ist alles andere als trivial.“ Recht hat sie. Wir Deutschen sollten mehr auf unsere Sprache achten. Anglizismen zum Beispiel, müssen die immer sein? Eine Frage des Sprachgefühls, denn in gewissen Zusammenhängen macht eine lebendige internationale Sprache durchaus Sinn. Keinesfalls aber als Automatismus, weil uns die Worte nun einmal auf der Zunge liegen.
Wir sollten nicht gedankenlos mit unserer Sprache umgehen. Allzu oft schleicht sich Vulgarität in der Wortwahl ein. Besonders wenn wir mit der Bahn oder aktueller Politik unzufrieden sind. Stammtischgerede halt. Da können sich die meisten selbst an die Nase fassen. Achten wir doch in Zukunft ein wenig mehr auf die Qualität unserer individuellen Ausdrucksweise.
Denn wenn wir uns für eine wertige Sprache sensibilisieren, bemerken wir auch mehr die Feinheiten und Zwischentöne in den verbalen Äußerungen anderer. Dann fällt uns auf, wenn getrommelt, manipuliert und sprachlich auf Veränderungen hingearbeitet wird. Wir überhören beispielsweise die Phrase von der „Kriegstüchtigkeit“ nicht mehr, die der Verteidigungsminister ganz nebenbei einwarf. Mit solcher Rhetorik werden nicht nur die Reaktionen des Volkes getestet, sie dienen auch dazu, Sprache frühzeitig an zukünftige Entwicklungen anzupassen.
Sprache ist verräterisch

Foto: tos
Denn seit dieser einen Äußerung mehren sich ähnliche Formulierungen. Sie tauchen immer wieder in stets kürzeren Abständen auf. Jüngst meinte die bayrische Gesundheitsministerin, die militärische Bedrohung durch Russland mache es notwendig, dass sich das Gesundheitssystem auf den Ernstfall vorbereite. Also wieder so ein Wort, das Krieg umschreibt und darauf vorbereitet: „Ernstfall“. Unabhängig von einer tatsächlichen Bedrohung wird hier etwas herbeigeredet und die Bevölkerung darauf vorbereitet. Was den Verdacht schürt, die Bedrohung geht nicht so sehr von fremden Mächten, als vielmehr von Kriegstreibern in den eigenen Reihen aus. Zumal alles Militärische wieder akzeptabler in Deutschland geworden ist. In sozialen Netzwerken posieren Männer wie Frauen stolz in Uniform und posten über ihre großartige Zeit bei Reserveübungen, während derer sie ihre staatsbürgerliche Pflicht erfüllen. Da drängt sich die Frage auf, ist es nicht eher
Verräterisch ist immer wieder die Sprache. Wer genau hinhört, stellt fest: Es wird der sogenannte Dienst am Vaterland glorifiziert. Die Wortwahl ist ein klein wenig militärischer. Das klingt harmlos, noch wie ein Spiel. Doch gewöhnen wir uns erst daran, ohne aufmerksam zu sein und manche Formulierung zurückzuweisen, führt uns dieser Beginn schnell zu echter Kriegstreiberei. Wenn wir unsere Sprache ernst nehmen – und das sollten wir unbedingt tun – geht es längst nicht mehr um deutschsprachige Popsongs, sondern um eine Bewahrung von Wohlstand und Frieden.
Der sprachliche Umgang miteinander sollte in allen gesellschaftlichen Gruppen wieder respektvoll und wertschätzend sein – auch und vielleicht sogar vor allem gegenüber schwierigen Gesprächspartnern. Es gibt keinen Grund, sich in Talkshows andauernd gegenseitig ins Wort zu fallen. Reden wir über alles mit wohlgewählten Worten und Sätzen und achten darauf, wer uns wie mit seinen Äußerungen auf was auch immer einstimmen will.